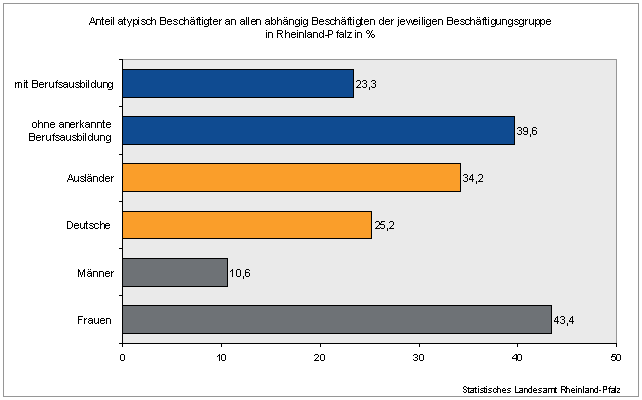
Immer mehr Beschäftigte arbeiten in neuen, häufig auch als „atypisch“ bezeichneten Beschäftigungsformen. Zu diesen neuen Beschäftigungsformen gehören befristete oder geringfügige Beschäftigung und Teilzeitarbeit mit 20 oder weniger Stunden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems stieg der Anteil der abhängig Beschäftigten in diesen Beschäftigungsformen in Rheinland-Pfalz zwischen 1998 und 2008 von 19,5 Prozent auf 25,8 Prozent (Deutschland: 1998: 18,2 Prozent, 2008: 25,2 Prozent). Das so genannte „Normalarbeitsverhältnis“ bleibt aber weiterhin die vorherrschende Beschäftigungsform.
Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern: Während sich 43,4 Prozent der abhängig beschäftigten Frauen im Jahr 2008 in einer „atypischen“ Beschäftigung befanden, traf dies nur auf 10,6 Prozent der Männer zu. Wesentliche Ursache hierfür ist die große Zahl von Frauen in Teilzeitarbeit, die in vielen Fällen auch durchaus gewollt ist (z. B. aus familiären Gründen). Überdurchschnittlich stark vertreten waren die neuen Beschäftigungsformen auch bei abhängig Beschäftigten ohne anerkannte Berufsausbildung (39,6 Prozent), Alleinerziehenden (41,5 Prozent) und Ausländern (34,1 Prozent).
Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, verfügen in der Regel auch gemeinschaftlich über das Haushaltseinkommen. So erleichtern mehrere Erwerbseinkommen die Finanzierung des Lebensunterhalts der Haushaltsmitglieder. 30,6 Prozent der „atypisch“ Beschäftigten lebten 2008 in einem Haushalt ohne weitere Erwerbstätige und konnten sich damit nur auf das eigene Erwerbseinkommen stützen. Mit mindestens einem Normalbeschäftigten lebten 54,5 Prozent der „atypisch“ Beschäftigten in einem Haushalt. 7 Prozent gaben an, mit einem oder eventuell mehreren „atypisch“ Beschäftigten zusammen zu leben und 7,9 Prozent befanden sich in anderen Haushalts-Erwerbskonstellationen (z. B. Selbstständige).
Der Haushaltszusammenhang spielt auch bei der Frage nach der Armutsgefährdung eine wichtige Rolle: „Atypisch“ Beschäftigte ohne weitere Erwerbstätige im Haushalt wiesen 2008 eine Armutsgefährdungsquote von 30,8 Prozent auf. In deutlich geringerem Maß von Armut bedroht waren hingegen „atypisch“ Beschäftigten, die mit mindestens einem Normalbeschäftigten zusammen lebten (Armutsgefährdungsquote: 3,5 Prozent). Insgesamt lag die Armutsgefährdungsquote der „atypisch“ Beschäftigten im Jahr 2008 bei 13,4 Prozent (Deutschland: 14,3 Prozent). Zum Vergleich: Die Armutsgefährdungsquote der abhängig Beschäftigten in einem Normalarbeitsverhältnis lag im Jahr 2008 bei 3,6 Prozent, die der abhängig Beschäftigten insgesamt bei 6,1 Prozent.
Atypisch Beschäftigte häufig unter der Niedriglohngrenze
Nach den Ergebnissen der alle vier Jahre stattfindenden Verdienststrukturerhebung erhielten im Oktober 2006 etwa 17 Prozent der rheinland-pfälzischen Beschäftigten einen Niedriglohn (Deutschland: 20 Prozent). In Anlehnung an eine OECD-Methode werden alle Beschäftigten, die in der Stunde weniger als 9,85 Euro brutto verdienen, dem Niedriglohnsektor zugerechnet. Teilzeitbeschäftigte mit 20 und weniger Stunden pro Woche, geringfügig und befristet Beschäftigte erzielen geringere Stundenverdienste als Beschäftigte in einem Normalarbeitsverhältnis und gehören dementsprechend überdurchschnittlich häufig dem Niedriglohnsektor an. In Rheinland-Pfalz verdienten im Oktober 2006 rund 81 Prozent der geringfügig Beschäftigten, 26 Prozent der befristet Beschäftigten und 14 Prozent der Teilzeitbeschäftigten weniger als 9,85 Euro brutto pro Stunde.
Die Daten stammen aus den Mikrozensusbefragungen 1998 und 2008. Bei dieser jährlichen Erhebung werden bei einem Prozent aller Haushalte Angaben über ihre wirtschaftliche und soziale Situation sowie Informationen zur Erwerbstätigkeit erfragt. In Rheinland-Pfalz werden für die Stichprobe jährlich 18.000 Haushalte ausgewählt. Die Auswertungen des Mikrozensus konzentrieren sich auf die abhängig Beschäftigten, die im Alter von 15 bis 64 Jahren und nicht in Bildung oder Ausbildung sind.
Die Armutsgefährdungsquote ist der Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 Prozent des Bundesmedians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
Im Rahmen der Verdienststrukturerhebung 2006 wurden in Rheinland-Pfalz mehr als 1.800 Betriebe (mit zehn und mehr Beschäftigten) aus dem produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungsbereich befragt. Diese Befragung findet alle vier Jahre statt.
Die Niedriglohngrenze wurde hier, in Anlehnung an eine OECD-Methode, definiert als zwei Drittel des nationalen Medianverdienst. Der Medianverdienst ist der Eurobetrag, der die Verteilung aller Beschäftigten nach ihrem Bruttostundenverdienste in zwei Hälften teilt; d. h. eine Hälfte verdient weniger, eine Hälfte verdient mehr als diesen Betrag.
Autorin: Christine Schomaker (Referat Mikrozensus, Verdienste, Preise, Haushaltserhebungen)
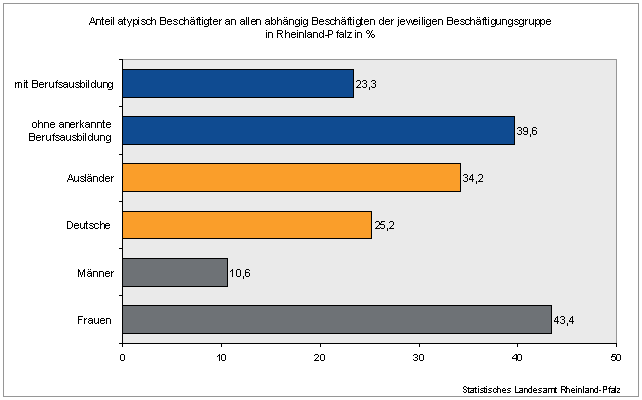
(112/09)